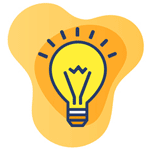Startseite » Grundlagen der Politischen Bildung » Politische Bildung – Grundbegriffe der Profession » Ambiguitätstoleranz (Grundbegriffe der Politischen Bildung)
Grundbegriffe
der Politischen Bildung
Ambiguitätstoleranz
- Transfer für Bildung e.V.
- 2. November 2022
Was Ambiguitätstoleranz ist, lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Als ambigue werden Situationen verstanden, die durch Mehrdeutigkeit, Ungewissheit, Neuartigkeit, hoher Komplexität und / oder Widersprüchlichkeit gekennzeichnet sind. Solche Situationen können bei Menschen Angst und Unwohlsein hervorrufen. Diese Gefühle können dann zur Verleugnung von Realitätsaspekten, Vermeidung ambiguer Situationen und destruktiven Handeln führen (siehe Ziegler/Titt 2022: 22). Demgegenüber wäre Ambiguitätstoleranz die Anerkennung und das Aushalten von sowie der konstruktive Umgang mit Ambiguität.
Uneindeutigkeit und Ungewissheit sind einerseits Grunderfahrungen menschlicher Existenz, nehmen in (spät-)modernen Gesellschaften und liberalen Demokratien jedoch an Intensität und Umfang zu. So erfordert demokratische Politik beispielsweise die Auseinandersetzung mit Menschen mit je eigenen Perspektiven, Einstellungen, Bedürfnissen und Interessen (siehe Lenz 2020: 15). Besonders Krisen und Transformationsprozesse produzieren darüber hinaus zusätzlich Ambiguitäten. Ambiguitätstoleranz wird dementsprechend als eine Bedingung dafür betrachtet sich konstruktiv an demokratischen Prozessen zu beteiligen. Indem sie dabei hilft, den Verführungen vermeintlich eindeutiger und sicherer Antworten und Lösungen zu widerstehen, öffnet sie den Raum für kritisches Denken, Reflexion und Kooperation.
Eine an der Mündigkeit des Subjekts orientierte politische Bildung kann dazu beitragen, die Ambiguitätstoleranz der Lernenden zu stärken. Dies schafft sie unter anderem durch die Befähigung zu kritischem Denken und Urteilen, mit dialogischen und partizipativen Lernformaten und der Ermöglichung, Perspektivenvielfalt und Pluralität zu erfahren (vgl. a.a.O.: 17). Gefahr läuft der Fokus auf Ambiguitätstoleranz jedoch, wenn ihre Abwesenheit als weiteres Defizit der Adressat*innen verstanden wird, welches es durch „Maßnahmen“ der politischen Bildung zu beheben gilt.
Weiterlesen
- Lenz, Claudia (2020): Ambiguitätstoleranz – ein zentrales Konzept für Demokratiebildung in diversen Gesellschaften. In: Schwarzkopf Stiftung Junges Europa: Educational Briefing 2020. Gleichheit, Unterschiedlichkeit, Mehrdeutigkeit – Kompetenz und Haltung für den Umgang mit Diversität in Bildungsprozessen. Online: https://schwarzkopf-stiftung.de/content/uploads/2021/10/educational_briefing_2020_de-1-1.pdf?x41391 (abgerufen am 21.09.2022).
- Ziegler, Rene / Titt, Raphael (2022): Ambiguitätstoleranz. Die Entwicklung des Konstrukts in der psychologischen Forschung. In: Deibl, Marlene / Mairinger, Katharina (Hrsg.): Eindeutig mehrdeutig. Ambiguitäten im Spannungsfeld von Gesellschaft, Wissenschaft und Religion. V&R, Göttingen

Transfer für Bildung e.V.
Der Verein Transfer für Bildung e.V. setzt sich für die politische und kulturelle Bildung ein. Er fördert deren Beforschung, Beratung und Begleitung der Praxis und unterstützt den Dialog von Wissenschaft, Praxis und Politik in diesen Bereichen.
Dieser Artikel ist Teil von:
Grundbegriffe der Politischen Bildung
Um Kontroversen, Positionen und Perspektiven in der Politischen Bildung einordnen zu können, braucht es Wissen um dahinterliegende Diskurse. Die Traditionslinien der Politischen Bildung schlagen sich dabei auch im Fachvokabular der Profession nieder. Die Begriffsprägungen zeigen somit Erkenntnisse, Konsense aber auch Konfliktlinien innerhalb des Fachdiskurses an. Der hierbei entstehende argumentative Dialog ringt dabei zugleich um Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Gemeinsam mit unseren Autor*innen aus der Politischen Bildung stellen wir an dieser Stelle Grundbegriffe der Politischen Bildung vor.
Vertiefende Dossiers